Als Alternative zu Freileitungen werden immer häufiger Erdkabel diskutiert. Das Projekt untersucht die Auswirkungen verschiedener Höchstspannungs-Erdkabelsysteme auf Natur und Landschaft und liefert Hinweise, um Erdkabeltrassen naturverträglich zu gestalten.
Die Erfahrungen mit dem Bau von Höchstspannungs-Erdkabeltrassen in Deutschland sind bisher begrenzt. Das Forschungsvorhaben zielte darauf ab, den Kenntnisstand über verschiedene Höchstspannungs-Erdkabelsysteme, ihre Wirkfaktoren und ihre Auswirkungen auf Natur und Landschaft zu verfeinern. Dazu wurde der Stand des Wissens durch die Auswertung von Fachliteratur und einschlägigen Projektunterlagen aus dem In- und Ausland ermittelt. Von den bereits realisierten Höchstspannungs-Erdkabeln wurden zudem die Erfahrungen aus der Bauphase ausgewertet. Eine Klärung der Relevanz betriebsbedingter Wärmeemissionen für die Planung und Genehmigung erfolgte auf Basis der Ergebnisse von Simulations- und Testanlagen. Ein Monitoring im Realbetrieb steht noch aus.
Das Projekt betrachtete des Weiteren den Bau von Erdkabeltrassen im Offenland, in Waldbereichen sowie in Annäherungsbereichen von Siedlungen. Die Bestockung der Erdkabeltrassen mit Gehölzen ist aufgrund von Schutzvorschriften eingeschränkt, was das naturschutzfachliche Entwicklungspotenzial insbesondere im Fall von Waldquerungen einschränkt. Es wurde daher der Frage nachgegangen, wie eine Trassengestaltung mit Gehölzen aussehen könnte, die im Einklang mit den sicherheitstechnischen Anforderungen steht.
Um den Stand von Wissenschaft und Praxis der HöS-Erdverkabelung zu ermitteln, wurden die einschlägige aktuelle Fachliteratur sowie Planungs- und Genehmigungsunterlagen von den in Deutschland und ausgewählten Nachbarländern (NL, DK, BE, GB, CH) realisierten bzw. aktuell geplanten HÖS-Projekten ausgewertet. Die projektbezogenen Unterlagen wurden im Hinblick auf technische Anforderungen und Ausführung, die als relevant erachteten Auswirkungen und die Trassengestaltung ausgewertet. Die Auswertung wurde durch Interviews und telefonische bzw. E-Mail-Auskünfte ergänzt. Drei HDÜ-Projekte (Raesfeld, Randstad-Zuidring, Vejle Ådal) wurden vor Ort besichtigt. Hierdurch sind eine breite Wissensbasis und ein Netzwerk an Ansprechpartnern für den Naturschutz entstanden.
Durch Internetrecherche und Befragung von Übertragungsnetzbetreibern wurden HöS-Erdkabelprojekte ermittelt und hinsichtlich der Übertragbarkeit auf die Situation in Deutschland geprüft. Mit Hilfe von Projektsteckbriefen wurden Projektdaten und -dimensionen, technische Auslegung und Bauweisen sowie Ansprechpartner und Projektunterlagen erfasst. Damit wurden auch Voraussetzungen für einen zukünftigen grenzüberschreitenden Wissensaustausch geschaffen.
Der Kenntnisstand über Wirkfaktoren und potenzielle Auswirkungen wurde auf Basis der Fachliteratur, durch die Auswertung von Planungs- und Genehmigungsunterlagen sowie von Bauberichten verfeinert. Einen Schwerpunkt bildete die Frage, welche Erkenntnisse bisher über das Auftreten von Wärmeemissionen und deren Auswirkungen auf den Boden (Erwärmung), den Wasserhaushalt (Austrocknung) sowie auf das Bodenleben vorliegen und welche Relevanz (Erheblichkeit) diesen Effekten in der Planungspraxis beigemessen wird. Es wurde ferner überprüft, inwieweit das Wirkungswissen aus anderen Leitungsprojekten (Erdgas, Fernwärme) übertragbar ist.
Ein Schwerpunkt lag auf der Untersuchung der Voraussetzungen für die naturverträgliche Trassengestaltung mit Gehölzen im Falle von Waldquerungen. Es wurden verschiedene Optionen für eine naturverträgliche Trassengestaltung mit Gehölzen unter Wahrung der Sicherheitsanforderungen im Schutzstreifen entwickelt.
Um diese Fragestellungen zu beantworten, wurde der Wissensstand über Wurzelverhalten und Wurzeltiefen verschiedener heimischer Baum- und Straucharten zusammengeführt. Daraus wurden Empfehlungen für den zukünftigen Umgang mit Gehölzen auf Kabeltrassen abgeleitet.
Die Umweltauswirkungen sind bei Drehstrom- und Gleichstrom-Vorhaben im Wesentlichen die gleichen. Die baubedingten Auswirkungen bilden den Schwerpunkt der Umweltwirkungen von Erdkabeln. Sie können durch eine Ökologische Baubegleitung vermindert oder vermieden werden. Die Temperaturveränderungen an der Bodenoberfläche durch Wärmeabgabe der Kabel liegen nach den bisherigen Erkenntnissen im Bereich der natürlichen Schwankungsbreite. Da die Erdkabeltechnologie auf der Höchstspannungsebene noch in der Entwicklung und Erprobung ist, sind für eine finale Bewertung derzeit noch nicht alle Randbedingungen klar.
Eine Querung von nicht zu umgehenden Hindernissen wie Straßen, Fließgewässern oder Kanälen kann durch Unterbohrung und Unterpressung erfolgen, für längere Abschnitte kommt als grabenlose Bauweise das Micro-Tunneling-Verfahren in Betracht. Diese Maßnahmen können auch zur Vermeidung von Umweltwirkungen eingesetzt werden.
Bei der Trassennutzung/Bepflanzung nach Baufertigstellung sind insbesondere im Schutzstreifen (Kabelgraben + Sicherheitsabstände) die Anforderungen der Netztreiber an Sicherheit und Zugänglichkeit zu beachten (keine tiefwurzelnden Gehölze > 1 m Wurzeltiefe). Auf dem Rest der Kabeltrasse sind die Restriktionen geringer. Damit kommen heimische Waldbaumarten für eine Pflanzung im Schutzstreifen nicht infrage. Die Schadwirkungen von Gehölzen beruhen im Wesentlichen auf Annahmen und Analogieschlüssen. Hier besteht Forschungsbedarf, um diese Annahmen zu verifizieren oder zu widerlegen.
Eine naturverträgliche Trassengestaltung ist aber auch unter Ausschluss von Pflanzen mit verholzenden, tiefgehenden Wurzeln möglich. Hierfür muss ein naturverträgliches Trassenmanagement etabliert werden. Die Einbindung eines Trassenmanagements in überregionale Biotopverbundsysteme scheint nur in einigen wenigen Fällen möglich zu sein.
Die Umweltwirkungen und die Notwendigkeit eines ökologischen Trassenmanagements werden in den europäischen Ländern unterschiedlich bewertet. Ein Austausch zu Maßstäben der Bewertung und Standards der Umsetzung ist wünschenswert.
Projektleitung
Deutsche Umwelthilfe e.V.
Dr. Peter Ahmels
Judith Grünert; Ole Brandmeyer
Hackescher Markt 4
10178 Berlin
Projektpartner
Institut für nachhaltige Energie- und Ressourcennutzung (INER)
Hochwildpfad 47
14169 Berlin
Dr. Elke Bruns
Fördergeber
Bundesamt für Naturschutz
FG II 4.3 Naturschutz und Erneuerbare Energien
Alte Messe 6, 04013 Leipzig
Friedhelm Igel
Tel: 0341 30977-165
Friedhelm.Igel(at)bfn.de
03.04.2024
Weiter

03.04.2024
Weiter
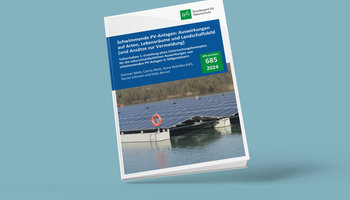
15.02.2023
Weiter
